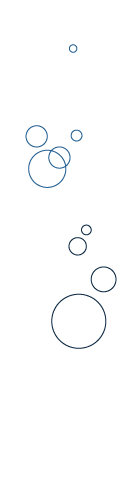5. Flussgebietsmanagement
Die Emscher-Lippe-Region
Kaum vorstellbar, aber bis etwa 1850 war dieses Gebiet eine ländliche
und dünn besiedelte Region. Bis auf wenige Städte entlang dem
Hellweg, einem schon seit über 5.000 Jahren genutzten Handelsweg
zwischen Duisburg und Paderborn, gab es hier nur kleine Dörfer.
Diese lagen verstreut zwischen Wiesen, Sumpfflächen, Feldern und
Wäldern. Heute - also nur rund 150 Jahre später - leben hier rund 3,8
Millionen Einwohner. Weite Teile der Emscher-Lippe-Region gehören
zu einem der größten städtischen Ballungsgebiete Europas, dem
Ruhrgebiet, und dieses verdankt seine Entwicklung in erster Linie
dem Vorkommen der Steinkohle.
Erste Erwähnungen von Kohlefunden reichen zurück bis in das 13.
Jahrhundert, aber bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war der Bergbau
lediglich eine willkommene Nebenbeschäftigung zur Landwirtschaft.
Zunächst erfolgte der Kohleabbau an den Hängen des
westlichen Ruhrtales. Hier trat die Kohle zu Tage und konnte mit
wenig Aufwand gewonnen werden, zumal die Förderung bis weit ins
19. Jahrhundert hinein allein durch die Kraft von Pferd und Mensch
möglich war. Aber der Bedarf an Kohle wuchs gewaltig, insbesondere
für die Eisen- und Stahlindustrie. Mit zunehmender Technisierung
konnten auch immer tiefer liegende Kohlevorkommen erschlossen
werden, und der Steinkohlebergbau wanderte von der Ruhr aus nordwärts.
Zechen entstanden überall dort, wo man die Kohle am besten
abbauen konnte, und das war meistens auf der "grünen Wiese". Um
genügend Arbeiter unterbringen zu können, errichteten die Bergbaugesellschaften
in der Nähe der Schächte Siedlungen, die schnell
wuchsen. Innerhalb von wenigen Jahren entstand so der Ballungsraum
zwischen Ruhr und Lippe. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
dehnten sich Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie weiter aus, die
Bevölkerungszahl wuchs auf fast vier Millionen Menschen. Hinzu kam
die chemische Industrie, die mit ihren hohen Schornsteinen vor allem
die Emscherzone prägte. Seit den 1960er Jahren befindet sich das
Ruhrgebiet erneut im Wandel. Die Kohlevorkommen sind nahezu
erschöpft oder nicht mehr wirtschaftlich abzubauen, der Bergbau
und die traditionell zugehörige "Schwerindustrie" - Stahlverarbeitung,
Hüttenwerke und Ähnliches - weichen zu Gunsten von Dienstleistungs- und
Hightechunternehmen.
Emscher und Lippe im Wandel der Zeit
Wassergeschichten

Emscher und Lippe sind typische Flachlandflüsse, die - wie die meisten Bäche und Flüsse in unserer Region - von Natur aus ein geringes Gefälle und somit eine geringe Fließgeschwindigkeit besitzen. Sie würden sich natürlicher Weise in zahlreichen Windungen (Mäandern) ihren Weg durch die Landschaft bahnen. So war auch die Emscher bis ins 19. Jahrhundert ein kleiner, träger Fluss in einem kaum besiedelten, von einer Sumpflandschaft geprägten Raum. Sie entspringt östlich von Dortmund bei Holzwickede und mündete damals noch bei Duisburg-Alsum in den Rhein. In früherer Zeit war die Emscher unberechenbar. Sie suchte sich ständig neue Wege und überschwemmte vor allem nach starken Regenfällen weite Gebiete. Auch ihre zahlreichen Zuflüsse hatten aufgrund des geringen Gefälles weit verzweigte Nebenarme, und so entstand eine sumpfige Flusslandschaft, der Emscherbruch.

Die Emscher war aber von jeher auch von großer Bedeutung für den
Menschen. Der Fluss war bekannt für seinen besonderen Fischreichtum.
Das Wasser wurde durch Wehre aufgestaut, und mit Hilfe der Wasserkraft
wurden Mühlen angetrieben. Mit dem Beginn des Bergbaus
verlor die Emscherregion ihren ländlichen Charakter. Die Abwässer
der neu entstandenen Industrieregion, eine teils giftige Brühe, hatten
verheerende Wirkungen auf die Wasserqualität der Flüsse und Bäche.
Diese wurden nach und nach zu stinkenden Kloaken. Gleichzeitig
verschlechterte sich ihr Abfluss durch großflächige Bergsenkungen
als Folge des Kohleabbaus. Zusätzlich pumpte der Bergbau noch
salzhaltiges Grubenwasser in die Gewässer. Überschwemmungen
wurden zum Regelfall, und faulende Abwässer in überfluteten Senken
führten zu heute kaum vorstellbar unhygienischen Zuständen.
Epidemien und Krankheiten wie Typhus und Malaria breiteten sich
aus. Da dieses Problem nur gemeinsam zu lösen war, schlossen sich
Vertreter der Gemeinden, der Industrie und des Bergbaus 1899
zusammen und gründeten die Emschergenossenschaft. Diese hatte
vor allem dafür zu sorgen, dass die Abwässer störungsfrei und möglichst
schnell in den Rhein flossen. Die Klärung des Abwassers war
nur mit einfachen Methoden möglich, und Naturschutz spielte zur
damaligen Zeit lediglich eine untergeordnete Rolle. Also wurden die
Emscher und ihre Nebengewässer größtenteils als offene
Schmutzwasserläufe begradigt und in Beton gefasst. Fast ein
Jahrhundert lang prägten die technisch ausgebaute Emscher und ihre
Nebenläufe das Gesicht der Region.
Die Lippe war schon im Mittelalter ein wichtiger Handelsweg. Im 12.
und 13. Jahrhundert wurden entlang dem Fluss die Städte Dorsten,
Haltern, Hamm, Lippstadt, Lünen und Wesel gegründet. Kein Wunder,
dass es schon Ende des 15. Jahrhunderts Pläne gab, die Lippe als
Schifffahrtsweg nutzbar zu machen. Es dauerte allerdings noch über
200 Jahre, bis die Lippe um 1830 durchgehend von Wesel bis
Lippstadt für Schiffe befahrbar war. Nach 1850 wuchs schnell das
Eisenbahnnetz und bot günstigere Transportmöglichkeiten. Zudem
versandete das Flussbett der Lippe immer wieder.

1890 begann man deshalb, für den Transport von Massengütern wie Kohle, Erz und
Baustoffe Schifffahrtskanäle zu bauen, den Dortmund-Ems-Kanal
(1899), den Datteln-Hamm-Kanal und den Rhein-Herne-Kanal
(1914) sowie den Wesel-Datteln-Kanal (1931). So entstand das Netz
der westdeutschen Kanäle, über das auch heute noch große
Mengen an Gütern transportiert werden. Gegen 1900 hielten Bergbau
und Industrie Einzug an der Lippe, und damit wuchsen auch hier die
Probleme mit der Wasserqualität. Immer mehr Wasser wurde
gebraucht, und immer mehr Abwässer verschiedenster Art verschmutzten
die Lippe und ihre Zuflüsse. Und wegen Bergsenkungen
mussten wie im Emschergebiet viele Bäche vertieft oder eingedeicht
werden. Zahlreiche Pumpwerke sorgen bis heute dafür, dass die
Senkungsmulden trocken gehalten werden. Die Lippe wurde örtlich
begradigt und verkürzt. Die Ufer sind weitestgehend befestigt.
Dadurch hat sich der Fluss bis zu drei Meter tief in den Untergrund
eingeschnitten.
Die Lippe zeigt heute zwei Gesichter: In den städtischen Bereichen,
in Hamm, Lünen und Dorsten sowie bei Marl, verläuft sie zwischen
Deichen. Ansonsten fließt sie in gewundenem Verlauf meist inmitten
von Wiesen, Weiden und Äckern, obwohl auch Industrieanlagen bis
nah an den Fluss heranrücken.