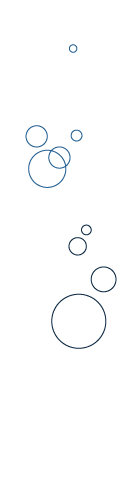1. Grundwissen Wasser
Der Wasservorrat

Auf unserer Erde tummelt sich das Wasser in jeder möglichen Gestalt
und Form: Als Ozeane, die die zusammenhängende Wasserfläche der
Erde bilden, als fließende Gewässer in Flüssen und Bächen, als stehende
Gewässer wie Seen, Tümpel, Teiche und Talsperren oder auch
versteckt als Grundwasser.
Die Erde erscheint vom Weltraum aus betrachtet als "Blauer Planet".
Kein Wunder, denn circa 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit
Wasser bedeckt, das sind zusammengerechnet rund 1,4 Trilliarden
(1.400.000.000.000.000.000.000) Liter Wasser, eine gigantische
Menge. Zum Vergleich: In einen Putzeimer passen rund zehn Liter
Wasser.
Doch von diesem enormen Wasserreichtum sind rund 97 Prozent
salzhaltig und nur etwa drei Prozent Süßwasser. Ein Großteil davon ist
wiederum entweder in den Eiskappen am Nord- und Südpol und als
Gletscher gefroren oder als Grundwasser vorhanden. Das Süßwasser
der Flüsse und Seen macht nur 0,01 Prozent der gesamten auf der
Erde vorhandenen Wassermenge aus. Da die Süßwasserreserven
sehr ungleichmäßig auf der Erde verteilt sind, gibt es viele Länder und
Kontinente mit Wasserknappheit.
Der Wasserkreislauf

Wasser bewegt sich in einem immerwährenden, genialen Kreislauf.
Der "Motor" dafür ist die Sonne: Durch die Wärme der Sonne verdunstet
ständig Feuchtigkeit, am meisten aus den Ozeanen, aber
auch aus den Flüssen und Seen und über dem Festland. Dabei entsteht
Wasserdampf, und da dieser leichter ist als Luft, steigt er nach
oben in die Atmosphäre und wird durch den Wind verteilt. In kühleren
Höhen kondensiert der Wasserdampf, wird also wieder flüssig, und
es entstehen Wolken. Wolken sind demnach nichts anderes als viele
kleine Wassertröpfchen, die in der Luft schweben. Ganz so einfach ist
das mit dem Kondensieren des Wasserdampfs allerdings nicht, denn
Wasserdampf neigt dazu, gasförmig zu bleiben. Erst wenn sogenannte
Kondensationskerne vorhanden sind, wechselt er tatsächlich
vom gasförmigen (Dampf) in den flüssigen Zustand (Tröpfchen). Als
Kondensationskerne dienen winzige Staubteilchen, die immer in der
Luft vorhanden sind. Bevor ein Wolkentröpfchen als Niederschlag zu
Boden fällt, muss es ordentlich wachsen: An dem Wolkentröpfchen
kondensiert weiterer Wasserdampf, und so wird es langsam größer.
Schließlich wird der Tropfen so schwer, dass er Richtung Erde fällt.
Ob es dann regnet, schneit oder auch hagelt, hängt von der Temperatur
ab. Der größte Teil des Niederschlags verdunstet wieder oder
fließt in Bäche, Flüsse und letztendlich ins Meer. Ein anderer Teil versickert
im Boden und kann von den Pflanzen aufgenommen und von
diesen wieder an die Luft abgegeben werden. Dabei haben die
Pflanzen einen großen Anteil an der Verdunstung über dem Festland.
So gibt ein Hektar Wald (100 x 100 Meter) im Sommer bis zu 40.000
Liter Wasser pro Tag an die Luft ab. Der Rest sickert durch verschiedene
Boden- und Gesteinsschichten und bildet das Grundwasser. An
manchen Stellen sprudelt das Wasser als Quelle wieder aus dem
Boden und fließt als Bach oder Fluss weiter. Das meiste Grundwasser
sickert unterirdisch den Flüssen zu, die es Richtung Meer transportieren
oder direkt ins Meer. Dort angekommen, verdunstet das Wasser
erneut, steigt als Wasserdampf zum Himmel, bildet Wolken ... und die
Reise beginnt von vorn.
Wir Menschen nutzen diesen natürlichen Wasserkreislauf und gewinnen
das Trinkwasser aus Grund- und Oberflächenwasser. Nach der
Nutzung gelangt auch dieses Wasser gereinigt wieder in die Flüsse,
und der Kreislauf des Wassers geht weiter.