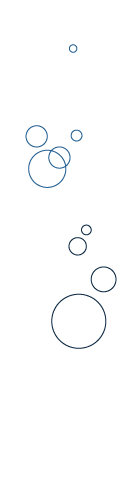4. Nachhaltigkeit
Ganzheitlicher Gewässerschutz
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Was macht der Rhein an der Grenze zu den Niederlanden? Er fließt einfach weiter. Und deswegen darf der Gewässerschutz auch nicht an einer für den Fluss beliebigen Grenze aufhören. Stattdessen sind ganzheitliche, länderübergreifende Konzepte notwendig - und genau deshalb gibt es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Ziel der Richtlinie ist es, europaweit die Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers deutlich zu verbessern. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, bis zum Jahr 2015 alle Oberflächengewässer (also die Seen, Bäche, Flüsse und Küstengewässer) sowie das Grundwasser in einen "guten Zustand" zu bringen. Für die Umsetzung der WRRL müssen alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne erstellen. Diese Pläne gelten grenzüberschreitend für sogenannte Flussgebietseinheiten. Das sind die natürlichen Räume der großen Fließgewässer (zum Beispiel der Rhein), ihre sogenannten Einzugsgebiete. Zu einem Einzugsgebiet gehören auch alle Zuflüsse und das zuströmende Grundwasser. Deutschland ist insgesamt an zehn Flussgebietseinheiten beteiligt. Für die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne sind umfangreiche Untersuchungen notwendig. Zuerst wird der Zustand der Gewässer und des Grundwassers untersucht und bewertet. Zur Beschreibung des ökologischen Zustands der Fließgewässer müssen drei Aspekte berücksichtigt werden:
- Lebensgemeinschaften. Dies beinhaltet eine Bewertung der Lebensbedingungen von Fischen über größere Wasserpflanzen bis hin zu Kleinlebewesen und Algen
- Wasserhaushalt und Gewässerstruktur, wie zum Beispiel Gewässer- und Uferbeschaffenheit, Durchgängigkeit und Abflussverhalten
- Wasserbeschaffenheit, also die Wasserqualität
Die Bewertung erfolgt nach einem einheitlichen System in fünf Stufen.
| Sehr gut | Lebensgemeinschaften, Wasserqualität sowie Wasserhaushalt und Struktur des Gewässers weisen keine oder nur geringfügige Abweichungen von einem Zustand auf, der ohne störende menschliche Einflüsse zu erwarten wäre. |
|---|---|
| Gut | Die Lebensgemeinschaften weisen auf geringe, vom Menschen verursachte Störungen hin, weichen aber nur geringfügig vom sehr guten Zustand ab. |
| Mäßig | Die Lebensgemeinschaften weisen auf signifikant stärkere Störungen hin und weichen mäßig vom sehr guten Zustand ab. |
| Unbefriedigend | Die Lebensgemeinschaften weichen erheblich von einem Zustand ohne menschliche Störungen ab. |
| Schlecht | Große Teile der Lebensgemeinschaften, die bei sehr gutem Zustand vorhanden wären, fehlen. |
Nach Analyse der maßgeblichen Belastungen werden realisierbare Maßnahmen zum Beispiel zur Verbesserung der Gewässerstrukturen geplant und umgesetzt. Dabei ist es oft schwierig, die Konflikte zwischen bestehenden Nutzungen an den Flüssen und den ökologischen Erfordernissen - also zwischen den Anforderungen von Mensch und Natur - zu lösen. Ein guter ökologischer Zustand für alle Gewässer kann in unserer dicht besiedelten und intensiv genutzten Landschaft nicht in allen Fällen oder jedenfalls nicht kurzfristig erreicht werden. Deshalb sind Ausnahmen möglich, wie zum Beispiel Abweichungen vom Bewirtschaftungsziel oder Fristverlängerungen.
Gewässergüte
Aber wann ist ein Fluss oder ein Bach in einem guten ökologischen
Zustand? Wenn ich darin schwimmen kann? Wenn ich das Wasser
trinken kann? Oder einfach nur, wenn er schön aussieht? Zur
Beurteilung des Gewässerzustandes sind genaue Kriterien und
Methoden notwendig. Von besonderer Bedeutung sind dabei die
Tiere und Pflanzen (Arteninventar).
Viele der Lebewesen, die in einem Bach oder Fluss leben, haben ganz
bestimmte Ansprüche an ihren Lebensraum. Einige brauchen klares
und sauerstoffreiches Wasser, andere dagegen bevorzugen nährstoffreichen
Schlamm. Das Vorkommen beziehungsweise die Häufigkeit solcher
Tiere lässt also auf eine bestimmte Wasserqualität schließen. Deshalb
werden sie auch als Zeigerarten (Indikatorarten) bezeichnet. Mit ihrer
Hilfe können Fließgewässer in verschiedene Gewässergüteklassen
eingeteilt werden. Eine bewährte Methode zur Bestimmung der
Gewässergüte ist das Saprobiensystem (abgeleitet von dem griechischen
Wort "sapros" = Fäulnis im Sinne von fäulnisfähiger, also
abbaubarer Substanz). Das Prinzip beruht darauf, dass der Grad der
Verschmutzung eines Fließgewässers mit biologisch abbaubaren,
nicht toxischen (giftigen) Stoffen die Zusammensetzung der darin
lebenden Tier- und Pflanzenwelt prägt. Die Funktionsweise ist einfach:
Wasserlebewesen brauchen Sauerstoff, bestimmte Arten
besonders viel, andere kommen mit weniger aus. Beim Abbau der
organischen Substanzen durch die Mikroorganismen wird Sauerstoff
verbraucht. Wird dieser zu knapp, verschwinden anspruchsvollere
Arten, und solche, die mit weniger Sauerstoff auskommen, breiten
sich in Massen aus. Je nach Vorkommen und Häufigkeit bestimmter
Zeigerarten können so die Fließgewässer in verschiedene Güteklassen
eingeteilt werden. Das bekannteste und bei uns am häufigsten angewendete
System unterscheidet vier verschiedene Güteklassen mit drei
Zwischenstufen, die mit römischen Ziffern gekennzeichnet und in den
Gütekarten in den Farben des Regenbogens dargestellt werden.
Bei der Güteklasse I ist das Wasser unbelastet oder sehr gering
belastet. Hierzu gehören Quellgebiete und Flussoberläufe mit reinem,
fast sauerstoffgesättigtem Wasser. Die Sauerstoffsättigung wird meist
in Prozent angegeben. Sie ist abhängig von der Temperatur, dem
Luftdruck und den im Wasser gelösten Stoffen. Sauerstoffgesättigtes
Wasser enthält die größtmögliche Menge an gelöstem Sauerstoff, also
100 Prozent Sättigung. Die Gewässer sind sehr nährstoffarm und werden
nur von wenigen Tieren besiedelt. Zeigerarten sind zum Beispiel
verschiedene Steinfliegenlarven. Fließgewässer der Güteklasse II
sind mäßig verunreinigt. Der Sauerstoffgehalt des Wassers schwankt,
liegt aber bei über 70 Prozent des Sättigungswertes. Hier fühlen sich
die Fische besonders wohl. Zu den Zeigerarten gehören Bachflohkrebse,
Eintags- und Köcherfliegenlarven. Gewässerabschnitte der Güteklasse
III sind stark verschmutzt, und das Wasser ist getrübt. Der
Sauerstoffgehalt schwankt zwischen 25 und 70 Prozent des Sättigungswertes,
sodass den Fischen manchmal die Luft ausgeht. Zeigerarten
sind beispielsweise Wasserassel und Rollegel. Bei Fließgewässern der
Güteklasse IV ist das Wasser übermäßig verschmutzt und stark
getrübt. Typisch sind Faulschlammablagerungen, die häufig nach
"faulen Eiern" (Schwefelwasserstoff) riechen. Der Sauerstoffgehalt ist
äußerst niedrig und sinkt fast auf null. Fische haben keine Überlebenschance.
Hier tummeln sich als Zeigerarten Zuckmückenlarven und
Rattenschwanzlarven. Die Güteklassen I und II sind für natürliche
Flüsse und Bäche charakteristisch, die anderen Klassen deuten meist
auf eine Verschmutzung durch uns Menschen hin. Die Bestimmung
der Gewässergüte nach dem Saprobiensystem ist eines von mehreren
Kriterien zur Beurteilung des ökologischen Zustands gemäß der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die fünfstufige Bewertungsskala
lässt sich vereinfacht wie folgt übertragen.
| Gewässergüteklasse | Ökologischer Zustand | |
|---|---|---|
| I | Unbelastet bis sehr gering belastet | 1 (sehr gut) |
| I-II | Gering belastet | 2 (gut) |
| II | Mäßig belastet | |
| II-III | Kritisch belastet | 3 (mäßig) |
| III | Stark verschmutzt | 4 (unbefriedigend) |
| III-IV | Sehr stark verschmutzt | 5 (schlecht) |
| IV | Übermäßig verschmutzt | |
Hellblau hinterlegte Begriffe werden in aktuellen Internetbrowsern bei Mausberührung erklärt.

Heutzutage werden so viele verschiedene Substanzen in unsere
Bäche und Flüsse eingeleitet, dass zusätzlich die Wasserqualität
regelmäßig im Labor untersucht wird. Gemessen werden chemische
und physikalische Parameter wie Wassertemperatur, pH-Wert, Sauerstoffgehalt
und Pflanzennährsalze (Stickstoff- und Phosphorverbindungen,
zum Beispiel Nitrate und Phosphate), aber auch giftige
Stoffe wie Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel und Industriechemikalien.
Und schließlich wurde alles Machbare getan, das Wasser ist sauber,
aber kein Fisch will darin schwimmen. Warum? Die Lebensbedingungen
in unseren Flüssen und Bächen werden nicht nur von der chemischen
Wasserqualität, sondern auch von der Strukturausstattung und der
Gewässerdynamik geprägt. Sauberes Wasser bedeutet aber nicht
automatisch auch eine gute Gewässerstruktur. Diese ist durch
Begradigung und technischen Ausbau der Fließgewässer sowie die
Zerstörung der natürlichen Auenlandschaften oft schwerwiegend verändert
worden. Dadurch fehlen in vielen Bächen und Flüssen die
charakteristischen artenreichen Lebensgemeinschaften.
Die Gewässerstrukturgüte ist ein Maß für den Natürlichkeitsgrad
eines Gewässers. Erfasst und bewertet werden hierbei alle Strukturen
im Wasser und am Ufer, aber auch das Gewässerumfeld, also die Aue
und deren Nutzung. Die Einteilung erfolgt in sieben verschiedene
Strukturgüteklassen von "unverändert" (Strukturgüteklasse 1) bis
"vollständig verändert" (Strukturgüteklasse 7).
Die Lippe und ihre Nebenbäche befanden sich bis Mitte der 1970er
Jahre in einem ausgesprochen schlechten Zustand. Aber besonders
durch den Bau von Kläranlagen hat sich die Situation deutlich verbessert.
Rund 75 Prozent der gesamten Gewässerstrecke sind heute
gering oder mäßig belastet (Gewässergüte I-II oder II) und nur ein
Prozent ist stark bis übermäßig verschmutzt (Gewässergüte III bis IV).
Trotzdem gibt es noch viel zu tun, besonders für die Gewässerstruktur.
Denn 43 Prozent der untersuchten Gewässerabschnitte sind sehr
stark oder übermäßig verändert, und nur sieben Prozent kann man
als natürlich oder weitestgehend naturnah bezeichnen. Das heißt, sie
sind unverändert oder gering verändert. An der Emscher und ihren
Nebenbächen ist die Situation schlechter als an der Lippe. Aber mit
dem 1991 begonnenen Umbau des Emschersystems verbessert sich
der Zustand Schritt für Schritt.
Durch die Umgestaltung der Bäche und Flüsse in der Emscher-Lippe-Region ist man auf einem guten Weg, im Sinne der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Erfordernisse in Einklang zu bringen. Allerdings sind dem naturnahen
Umbau der Fließgewässer hier auch Grenzen gesetzt. Durch nicht wieder
umkehrbare Eingriffe des Menschen, wie zum Beispiel Bergsenkungen
als Folge des Kohleabbaus, wurde die Landschaft dauerhaft
verändert. Gewässerbegleitende Deiche und zahlreiche Pumpwerke
werden deshalb auch zukünftig bestehen bleiben müssen.