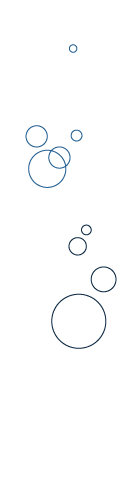2. Wasser als Lebensraum
Gewässerdynamik und Gewässerstruktur

Bäche und Flüsse mit ihren Talauen sind Lebensräume von außerordent-
licher
Vielfalt und Schönheit. Aber was ist das Besondere an
ihnen, verglichen mit einem See oder Teich? Es ist das Fließen!
Das ständig fließende Wasser hat Täler geschaffen und Flussauen
geformt. Dabei ist die Strömung die entscheidende Kraft. Die
Fließgeschwindigkeit und damit die Stärke der Strömung ist abhängig
von der Neigung des Geländes, also dessen Gefälle, und der
Wassermenge. Ist die Strömung stark, wird Material vom Ufer und
von der Gewässersohle abgetragen (Erosion), und Steine, Sand und
Kies werden mitgeführt (Transport). Sinkt die Fließgeschwindigkeit,
können zunächst die Steine und der Kies, dann aber auch der Sand
ab einem bestimmten Gewicht nicht mehr transportiert werden. Sie
lagern sich ab (Sedimentation). Durch diese Dynamik finden ständig
Veränderungen statt. Das wirkt sich auch auf den Flusslauf aus. So
haben Flachlandflüsse das Bestreben, in Schlangenlinien zu fließen.
Die Flussschlingen nennt man Mäander. Sie entstehen, wenn der
Fluss ein geringes Gefälle hat oder einem Hindernis ausweicht. Er
bildet zunächst eine schwache Kurve. Die stärkste Strömung (Stromstrich)
ist nun nicht mehr in der Mitte des Flusses, sondern das
Wasser "prallt" auf die Außenkurve. Man spricht deshalb auch vom
Prallhang. Durch die Kraft des Wassers wird das Ufer immer mehr
ausgehöhlt, und schließlich bricht es ab. So kann eine mehrere Meter
hohe Steilwand entstehen. An der Innenkurve hingegen fließt das
Wasser langsamer. Hier lagert sich das Material ab, und es bildet sich
ein flacher Uferbereich, der sogenannte Gleithang. Die Mäander
eines Flusses verändern sich immer weiter. Bei ganz extremer
Schlingenbildung kann es vorkommen, dass der Fluss an einer
Engstelle durchbricht und eine komplette Schleife "abschneidet". Ein
sogenannter Altarm ist entstanden. Bäche und Flüsse der Gebirge
zeigen ein anderes Verhalten: Sie sind besonders schnell fließend,
und ihr Verlauf ist ziemlich gerade (gestreckt). Mäander kommen nur
selten vor.

Diese Eigendynamik der Fließgewässer macht man sich übrigens bei
der Gewässerrenaturierung zu Nutze. Gibt man einem begradigten
Bach oder Fluss genug Platz und Zeit, gestaltet er sich sein Flussbett
neu. Dies kann man beispielsweise eindrucksvoll an der Lippe und an
einigen Bächen im Emschergebiet beobachten.
Dynamik und Strukturvielfalt sind die wesentlichen Kennzeichen
eines natürlichen Fließgewässers. Mal ist das Gewässer breit und
verzweigt sich, dann verengt es sich wieder. Mal fließt das Wasser
schnell, dann langsam. Ist die Strömung nur gering, entstehen Lehm-,
Sand- und Kiesbänke. Hindernisse wie Steine und Totholz behindern
seinen Lauf, es bilden sich Turbulenzen, was zu Vertiefungen,
den sogenannten Kolken führt. Entsprechend vielfältig sind auch die
Bestandteile der Gewässersohle, die natürlicherweise aus Kies, Sand,
Lehm oder größeren Steinen sowie - ganz wichtig für viele Lebewesen
als Nahrungsgrundlage und Versteckplatz - Holz und Falllaub besteht
und vom Wasser ständig umgelagert und durchströmt wird. Die
Bestandteile des Gewässergrundes nennt man Sohlsubstrate. Nur
durch diese Vielzahl von Strukturen kann sich in einem Bach oder
Fluss eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt ansiedeln. Deshalb ist
die Gewässerstruktur auch ein wichtiges Kriterium bei der ökologischen
Bewertung von Fließgewässern.
Wer einen Flusslauf von der Quelle bis zur Mündung etwas genauer
untersucht, stellt fest, dass sich die prägenden ökologischen Faktoren
wie Fließgeschwindigkeit, Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt des
Wassers und Beschaffenheit des Untergrundes auf eine ganz typische
Weise verändern. Das bedeutet, ein Fluss bietet seinen
Bewohnern ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Im oberen
Flusslauf haben wir meist kühleres Wasser, das sehr schnell fließt
und Gerölle, Kies und Sand mitnehmen kann.
Zur Mündung hin nimmt die Strömung immer mehr ab, der Fluss wird
breiter und träger. Das Wasser erwärmt sich, und immer mehr Kies
und Sand lagern sich ab. Diese Veränderungen sind so charakteristisch,
dass man die Fließgewässer in bestimmte Flussregionen einteilt.
Diese sind nach Fischen benannt, die in der jeweiligen Zone ihre
günstigsten Lebensvoraussetzungen finden und deshalb dort zahlreich
vorkommen.
Aber nicht alle Bäche und Flüsse sind gleich. Je nach der Landschaft,
in der sie fließen, gibt es - wie bei uns Menschen auch - unterschiedliche
"Typen", eben "Gewässertypen": In Gebirgen finden sich vor
allem Gewässer mit groben Substraten wie Steinen und Geröll, im
Tiefland gibt es Sand-, Kies-, Lehm- und in Moorgebieten sogar
Torfbäche. Die Tiefland-Fließgewässer in unserem Raum lassen sich
nur sehr grob anhand der Flussregionen unterteilen. Deswegen
erfolgt eine genauere Zuordnung über die Gewässertypen.
Bei uns müssen die Bäche und Flüsse meist nur geringe Höhenunterschiede
überwinden und haben deshalb nur ein geringes
Gefälle. Bei der Emscher und der Lippe beispielsweise betragen die
Höhenunterschiede von der Quelle bis zur Mündung (beide Flüsse
münden in den Rhein) jeweils nur rund 120 Meter. Dabei legt die
Emscher 85 Kilometer zurück und die Lippe sogar 220 Kilometer. Vor
ihrem Ausbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts schlängelten sich
Emscher und Lippe als Tieflandflüsse durch die Landschaft und vor
allem die Emscher suchte sich ständig neue Wege.